Das Wichtigste zur Zahlungsstockung
Nach § 17 II InsO gilt der Schuldner als „zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat.“
Nein. Bei einer bloßen Zahlungsstockung handelt es sich lediglich um einen kurzfristigen finanziellen Engpass dar. Der Schuldner hat zwar Schwierigkeiten zu zahlen. Er ist vorübergehend nicht liquide. Deshalb ist die Zahlungsstockung auch kein Eröffnungsgrund im Sinne der Insolvenzordnung dar.
Zahlungsstockung liegt laut Definition vor, wenn es dem Schuldner gelingt, sich die erforderlichen finanziellen Mittel innerhalb des Zeitraums zu beschaffen, den eine kreditwürdige Person hierzu brauchen würde. In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Kriterien der Bundesgerichtshof für das Vorliegen einer bloßen Zahlungsstockung aufgestellt hat.
Inhalt
Abgrenzung zwischen Zahlungsunfähigkeit und Zahlungsstockung
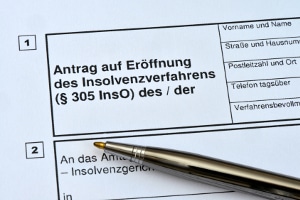
Ausschlaggebend dafür, ob Zahlungsunfähigkeit vorliegt, ist nach § 17 Abs. 2 InsO der Zeitpunkt der Fälligkeit einer Forderung. Dieser kann durch eine Stundungsvereinbarung, also einen Zahlungsaufschub hinausgezögert werden.
Manchmal lässt sich der finanzielle Engpass eines Schuldners durch einen solchen Aufschub beseitigen. Handelt es sich also um kurzfristig behebbare Zahlungsschwierigkeiten, so ist lediglich eine Zahlungsstockung anzunehmen. In diesem Fall ist das Unternehmen eben (noch) nicht zahlungsunfähig.
Der Bundesgerichtshof legt zur Abgrenzung einen Zeitraum von maximal drei Wochen zugrunde. In diesem Zeitraum könne ein kreditwürdiger Schuldner seinen Zahlungsengpass mithilfe eines Darlehens überbrücken (BGH, Beschluss vom 23.05.2007, Az. 1 StR 88/07). Gelingt es ihm in dieser Zeit jedoch nicht, seinen Engpass zu überwinden, so gilt er als zahlungsunfähig.
Um zu ermitteln, ob statt der Zahlungsstockung schon der Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit vorliegt, sind …
- die fälligen Verbindlichkeiten und
- die zu ihrer Bezahlung erforderlichen Mittel
stichtagsbezogen gegenüberzustellen.
Des Weiteren bedarf es einer Prognose darüber, ob das Unternehmen in der Lage ist, seine Zahlungsfähigkeit kurzfristig wiederherzustellen, indem es z. B. Kredite, Eigenkapital oder Einnahmen aus dem täglichen Geschäftsbetrieb verwendet oder Vermögensgegenstände veräußert.
Zahlungsstockung: Grundsätze des Bundesgerichtshofs
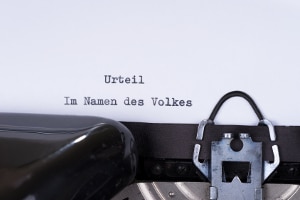
In seinem Grundsatzurteil vom 24.05.2005 (BGH, IX ZR 123/04) legt der Bundesgerichtshof folgende Kriterien zur Abgrenzung einer Zahlungsstockung von der Zahlungsunfähigkeit fest:
Wird der Zeitraum nicht überschritten, den eine kreditwürdige Person benötigt, um sich die erforderlichen finanziellen Mittel zu leihen, so liegt nur eine bloße Zahlungsstockung vor. Hierfür genügen in der Regel drei Wochen.
„Beträgt eine innerhalb von drei Wochen nicht zu beseitigende Liquiditätslücke des Schuldners weniger als 10 % seiner fälligen Gesamtverbindlichkeiten, ist regelmäßig von Zahlungsfähigkeit auszugehen, es sei denn, es ist bereits absehbar, dass die Lücke demnächst mehr als 10 % erreichen wird.“
[2. Leitsatz zum BGH-Urteil Az. IX ZR 123/04]
Liegt die Liquiditätslücke bei 10 Prozent oder mehr, so liegt in der Zahlungsunfähigkeit vor. In diesem Fall kommt eine Zahlungsstockung nur dann in Betracht, wenn nicht ausnahmsweise mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass der Schuldner diese Lücke demnächst (fast) vollständig beseitigt und den Gläubigern nach den besonderen Umständen des Einzelfalls das Warten hierauf zugemutet werden kann.
Wann besteht eine Insolvenzantragspflicht?

Gerät ein Unternehmen in finanzielle Not, so sind die gesetzlichen Vertreter unter Umständen verpflichtet, innerhalb von drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzantrag zu stellen. Geregelt ist dies in § 15a I 1 Insolvenzordnung (InsO).
Diese Pflicht gilt für juristische Personen wie die GmbH sowie für Gesellschaften, deren persönlich haftende Gesellschafter keine natürlichen Personen ist, wie beispielsweise bei der GmbH & Co.
Dieser Pflicht können die Verantwortlichen aber nur nachkommen, wenn sie die wirtschaftliche Situation des Unternehmens genau kennen und einschätzen können, ob nur eine vorübergehende, behebbare Zahlungsstockung vorliegt oder ob das Unternehmen bereits zahlungsunfähig ist.
Die Frage ist von höchster Bedeutung und bringt die Verantwortlichen mitunter in eine Zwickmühle. Kommen sie ihrer Antragspflicht nicht nach, steht schnell der Vorwurf einer strafbaren Insolvenzverschleppung in Raum. Stellt jedoch ein Geschäftsführer unberechtigterweise einen Insolvenzantrag, haftet er hierfür gegenüber den Gesellschaftern und der Gesellschaft.



 (30 Bewertungen, Durchschnitt: 3,90 von 5)
(30 Bewertungen, Durchschnitt: 3,90 von 5)