Das Wichtigste zum Veritätsrisiko
Echtes Factoring ist ein Forderungskauf im Wege der Abtretung. Der Factor kauft eine Forderung vom Factor-Nehmer, dem ursprünglichen Inhaber und Gläubiger der Forderung, und bezahlt ihm den Forderungsgegenwert. Außerdem übernimmt der Factor das Risiko, dass der Schuldner der Forderung diese nicht bezahlt (Delkredererisiko). Im Gegenzug behält er einen gewissen Prozentsatz des Forderungsgegenwertes ein. Ein solches Geschäft funktioniert natürlich nur, wenn die Forderung tatsächlich besteht (sogenannte Verität).
Der Begriff „Verität“ weist auf den eingeschränkten oder gänzlich fehlenden rechtlichen Bestand von Forderungen hin. Demnach bezeichnet das Veritätsrisiko laut Definition die Gefahr, dass eine Forderung teilweise oder gar keinen rechtlichen Bestand hat, dass sie also gar nicht (mehr) existiert. Näheres erfahren Sie hier.
Die Veritätshaftung beim Forderungskauf trifft den Forderungsverkäufer. Er haftet gegenüber dem Factor bzw. Käufer dafür, dass die verkaufte Forderung auch Bestand hat.
Inhalt
Echtes Factoring und die Veritätsrisiken bei angekauften Forderungen

Einige Unternehmen steigern ihre Liquidität, indem sie die Forderungen, die sie gegen ihre Kunden haben, an einen Dritten, den Factor, verkaufen. Dieses Vorgehen wird auch echtes Factoring genannt. Es hat einige Vorteile:
- Unternehmen gelangen schneller an Geld und können dadurch besser wirtschaften und investieren.
- Sie müssen sich nicht mehr darum kümmern, dass ihre Kunden pünktlich bezahlen. Das übernimmt der Factor.
- Außerdem ist der Forderungsverkäufer, der Factor-Nehmer, das Risiko los, dass sein Kunde die Forderung nicht bezahlen kann (sogenanntes Delkredererisiko).
Eine Gefahr bleibt aber weiterhin bestehen, nämlich die, dass die verkaufte Forderung gar nicht besteht und der Factor bzw. Käufer damit etwas bezahlt, was gar nicht existiert. Fachleute sprechen hier vom Veritätsrisiko. Die Verität, also das Bestehen einer Forderung, ist Voraussetzung dafür, dass ein solches Geschäft überhaupt funktioniert.
Welche Gründe gibt es für das Nichtbestehen einer Forderung?

Der Forderungskäufer erwirbt eine Forderung, ohne diese und den Schuldner wirklich zu kennen. Sämtliche Einwendungen und Einreden des Schuldners bleiben unverändert bestehen. Er kann sie auch gegenüber dem neuen Gläubiger geltend machen.
Dieses Veritätsrisiko kann auf verschiedenen Umständen beruhen, zum Beispiel auf …
- Abtretungsverbot: Das ist eine vertragliche Klausel, die dem Gläubiger die Abtretung der Forderung an einen Dritten verbietet. In einem solchen Fall darf ein Forderungsinhaber seine Forderungen nicht an einen Factor verkaufen.
- Erfüllung: Der Schuldner hat die Forderung bereits bezahlt, womit das zugrundeliegende Geschäft erlischt.
- Verjährung: Nach einer bestimmten Zeit, gewöhnlich nach drei Jahren, verjähren alle Ansprüche und Forderungen. Der Schuldner kann die Leistung danach verweigern, auch gegenüber dem Factor als neuem Gläubiger.
- Täuschung: Der Verkäufer täuscht dem Käufer vorsätzlich das Bestehen einer Forderung vor, die es gar nicht gibt.
Auch bei einem mündlich geschlossenen Vertrag besteht ein Veritätsrisiko, obwohl die Forderung existiert. Denn mündliche Verträge sind zwar meistens rechtswirksam, aber ihr Bestehen und ihr Inhalt lassen sich nicht nachweisen. Deshalb kann eine solche Forderung auch nicht verkauft werden.
Wer trägt das Veritätsrisiko beim Factoring?
Der ursprüngliche Gläubiger steht in einem Schuldverhältnis zum Schuldner und kann die Verität der darauf beruhenden Forderung am besten beurteilen. Der Factor als neuer Gläubiger kann das nicht, weil er keinerlei Beziehung zum Schuldner und zur Forderung hat. Er kann nicht einschätzen, ob die Forderung noch besteht und inwieweit sie durchsetzbar und eintreibbar ist.
Aus diesem Grund legt der Gesetzgeber dem Forderungsverkäufer das Veritätsrisiko auf, um das Vertrauen des Käufers in den Forderungsankauf zu schützen.
Der ursprüngliche Gläubiger muss dem neuen Gläubiger den Bestand der Forderung nachweisen, beispielsweise durch …
- Rechnungen und Verträge als Beweis für das Entstehen der Forderung
- Abtretungsanzeige, in deren Rahmen der Schuldner die Existenz der Forderung bestätigt und anerkennt
Stellt sich im Nachhinein trotz dieser Nachweise heraus, dass die Forderung nicht besteht, haftet der Verkäufer gegenüber dem Käufer nach § 311a Abs. 2 BGB. Letzterer kann in diesem Fall Schadensersatz oder Aufwendungsersatz verlangen.
Worin unterscheiden sich Bonitätsrisiko und Veritätsrisiko?
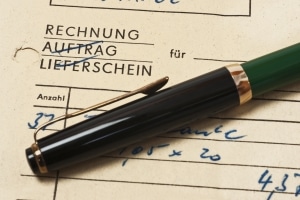
Selbst wenn eine Forderung existiert und ihre Verität damit gegeben ist, kann es passieren, dass der neue Gläubiger diese nicht eintreiben kann, weil der Schuldner zum Beispiel zahlungsunfähig ist. Diese Gefahr wird als Bonitätsrisiko oder Zahlungsausfallrisiko bezeichnet. Sie darf nicht mit dem Veritätsrisiko verwechselt werden.
- Beim echten Factoring übernimmt der Factor als neuer Gläubiger dieses Risiko. Der Forderungsverkäufer haftet demnach nicht, wenn der Schuldner insolvent ist oder nicht zahlt. Stattdessen muss der Factor den daraus entstehenden Schaden allein tragen.
- Beim unechten Factoring verbleibt das Bonitätsrisiko beim Verkäufer der Forderung. Ist der Schuldner zahlungsunfähig oder -unwillig, muss der Forderungsverkäufer die Kaufsumme zurückerstatten.
Informative Ratgeber rund um die Abtretung (§ 398 BGB):


 (46 Bewertungen, Durchschnitt: 4,46 von 5)
(46 Bewertungen, Durchschnitt: 4,46 von 5)