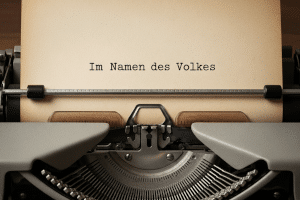
Die Restschuldbefreiung bietet überschuldeten Menschen die Chance auf einen Neuanfang. Doch während der Privatinsolvenz gelten bestimmte Spielregeln, die nicht immer einfach zu verstehen sind. Hinzu kommt, dass Schuldner und Gläubiger gegensätzliche Interessen verfolgen:
Der Schuldner möchte möglichst viel Einkommen und Vermögen behalten und am Ende des Verfahrens von seinen restlichen Verbindlichkeiten befreit werden. Die Gläubiger streben eine vollständige Bezahlung ihrer Forderungen an. Je mehr Einkommen und Vermögen des Schuldners verwertet wird, desto besser für sie – an der Restschuldbefreiung des Schuldners haben sie kein Interesse.
Deshalb kommt es häufiger zu Streitigkeiten, mit denen sich die Gerichte auseinandersetzen müssen. Wir stellen wichtige Urteile im Insolvenzrecht vor und erklären, welche Folgen sie für die Beteiligten haben.
Inhalt
Versagung der Restschuldbefreiung bei Teilzeitbeschäftigung

Es gibt Urteile zur Privatinsolvenz, in denen die Richter klarstellen, wie weit die Erwerbsobliegenheit des Schuldners geht.
Während der Wohlverhaltensphase müssen Schuldner einer angemessenen Erwerbstätigkeit nachgehen oder, wenn sie arbeitslos sind, sich um eine entsprechende Arbeitsstelle bemühen. Wer dies nicht tut, riskiert die Versagung der Restschuldbefreiung.
Aber: Welche Beschäftigung ist angemessen? Reicht zum Beispiel eine Teilzeitbeschäftigung aus? Eines der wichtigsten BGH-Urteile zum Insolvenzrecht beschäftigt sich mit genau dieser Frage.
In seinem Beschluss vom 01.03.2018 stellt der Bundesgerichtshof Folgendes klar:
„Der teilzeitbeschäftigte Schuldner muss sich grundsätzlich in gleicher Weise wie der erfolglose selbständig tätige und der erwerbslose Schuldner um eine angemessene Vollzeitbeschäftigung bemühen.“
In dem zugrunde liegenden Streitfall beantragte eine Gläubigerin die Versagung der Restschuldbefreiung. Sie begründete dies damit, dass der Schuldner nur einer Teilzeitbeschäftigung nachgegangen sei und damit gegen seine Erwerbsobliegenheit verstoßen habe.
Der Bundesgerichtshof sah das genauso und erklärte, dass grundsätzlich nur eine Vollzeitbeschäftigung angemessen sei. Teilzeitbeschäftigte Schuldner erfüllen nur dann ihre Erwerbsobliegenheit, wenn sie sich bei der Arbeitsagentur arbeitssuchend melden und aktiv nach einer Vollzeitstelle suchen.
Im vorliegenden Fall hatte sich der Schuldner im Schnitt nur vier Mal pro Jahr auf Vollzeitstellen beworben. Das hielt der Bundesgerichtshof für deutlich zu wenig.
Quelle: BGH, Beschluss vom 1.3.2018, IX ZB 32/17
Es gibt zahlreiche weitere Urteile im Insolvenzrecht, die den Umfang der Erwerbsobliegenheit konkretisieren. Denn das ist immer eine Frage des Einzelfalls und richtet sich auch nach den Bedürfnissen und Lebensumständen des Schuldners. Wer beispielsweise kleine Kinder zu betreuen hat oder gesundheitsbedingt nicht (Vollzeit) arbeiten kann, muss gewöhnlich auch keiner Vollzeittätigkeit nachgehen.
Kein Verzicht auf die Wirkung der Restschuldbefreiung in AGB
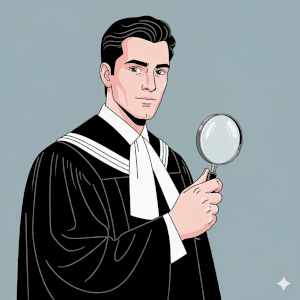
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) können den Unternehmen das Geschäftsleben enorm erleichtern, indem sie einheitliche Vertragsbedingungen für eine Vielzahl von Verträgen festlegen. Doch manchmal versuchen deren Verfasser, ihre Geschäftsinteressen mithilfe solcher AGB zum Nachteil ihrer Vertragspartner durchzusetzen.
In einem der Urteile zum Insolvenzrecht erklärte der BGH einen solchen Benachteiligungsversuch einen Riegel vor.
Er entschied, dass ein im Voraus erklärter Verzicht auf die Wirkungen der Restschuldbefreiung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam ist.
Quelle: BGH, Urteil v. 25.06.2015, IX ZR 199/14
Mit der erteilten Restschuldbefreiung wird der Schuldner von allen noch offenen Verbindlichkeiten befreit. Diese Forderungen sind nicht mehr durchsetzbar. Versucht ein Gläubiger, trotzdem die Zwangsvollstreckung einzuleiten, kann der Schuldner gerichtlich dagegen vorgehen.
Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit in der Privatinsolvenz unpfändbar
Andere Urteile zum Insolvenzrecht beantworten die Frage, welches Einkommen während der Privatinsolvenz pfändbar und damit als Insolvenzmasse verwertbar ist und welches Einkommen allein dem Schuldner zusteht. So auch im folgenden Fall:
Ein Bademeister arbeitet während der Saison auch an den Wochenenden und Feiertagen im Freibad. Dafür erhält er zusätzlich zum Lohn Zuschläge für seine Arbeit an Samstagen ab 13 Uhr, an Sonntagen und an Feiertagen.
Als der Mann Privatinsolvenz anmelden muss, beantragt er beim Insolvenzgericht die Anordnung der Unpfändbarkeit seiner Samstags-, Sonntags- und Feiertagszuschläge. Daraus entsteht ein Rechtsstreit, der schließlich vor dem BGH landet. Dessen Richter urteilen wie folgt:
Die Zuschläge für Sonntags- und Feiertagsarbeit sind Erschwerniszulagen und deshalb nach § 850a Nr. 3 ZPO unpfändbar. Es handelt sich deshalb um Erschwerniszulagen, weil die Arbeit außerhalb der regulären Arbeitszeiten einen Beschäftigten deutlich stärker belastet und sich nachteilig auf seine sozialen Beziehungen auswirkt.
Zulagen für Schicht- und Samstagsarbeit fallen jedoch nicht unter diese Regelung und sind demnach pfändbar.
Quelle: BGH, Beschluss vom 20.09.2018, IX ZB 41/16
Zur Insolvenzanfechtung von Lohnzahlungen

Der Insolvenzverwalter kann Zahlungen und Rechtshandlungen rückgängig machen, die der Schuldner vor der Insolvenzeröffnung vorgenommen hat.
Das führt mitunter zum Streit, sodass auch zu dieser Insolvenzanfechtung zahlreiche Urteile existieren, wie im folgenden Beispiel:
Ein Arbeitgeber muss Insolvenz anmelden. Kurz vorher zahlt er noch Lohn an seinen Arbeitnehmer – allerdings unter dem Druck bevorstehender Zwangsvollstreckungsmaßnahmen.
Der Insolvenzverwalter fordert dieses Geld vom Arbeitnehmer zurück und beruft sich dabei auf § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO. Der Arbeitnehmer weigert sich, den Lohn zurückzuzahlen. Er ist der Ansicht, diese Vorschrift verstoße gegen das Sozialstaatsprinzip und Art. 3 GG und sei damit verfassungswidrig, weil wirtschaftlich starke Gläubiger gegenüber abhängig Beschäftigten bevorzugt würden.
Das Bundesarbeitsgericht teilt diese verfassungsrechtlichen Bedenken nicht, denn die Insolvenzanfechtung nach § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO sorgt lediglich dafür, dass die Gläubiger bereits vor der Insolvenzeröffnung gleichbehandelt werden. Dieser Grundsatz der Gläubigergleichbehandlung ist ein wesentlicher Grundsatz der Insolvenzordnung.
Außerdem beseitigt diese Anfechtbarkeit Sondervorteile, die einzelne Gläubiger mit dem Druckmittel der Zwangsvollstreckung erlangen.
Deshalb darf der Insolvenzverwalter Gehaltszahlungen, die der Arbeitnehmer kurz vor der Insolvenz seines Arbeitgebers bekommen hat, im Wege der Insolvenzanfechtung zurückverlangen.
Quelle: BAG, Urteil vom 27.02.2014, 6 AZR 367/13
Datenspeicherung bei der SCHUFA: Eines der wichtigsten Urteile im Insolvenzrecht
Die Restschuldbefreiung soll Schuldnern einen wirtschaftlichen Neuanfang ermöglichen. Lange Zeit war das nur schöne Theorie, denn bis 2023 speicherte die SCHUFA die Erteilung der Restschuldbefreiung für weitere drei Jahre – mit der Folge, dass die Betroffenen immer noch als kreditunwürdig galten.
Im Jahr 2023 entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH), dass private Wirtschaftsauskunfteien diese Daten nicht länger speichern dürfen als die öffentlichen Insolvenzregister. Diese löschen die Information bereits nach sechs Monaten.
Kurz nach diesem Urteil hat die SCHUFA die Speicherfrist für die Erteilung der Restschuldbefreiung freiwillig auf sechs Monate verkürzt.
Quelle: EuGH, Urteile vom 07.12.2023, C-26/22 und C-64/22


 (60 Bewertungen, Durchschnitt: 4,70 von 5)
(60 Bewertungen, Durchschnitt: 4,70 von 5)