Kurz & knapp: Das Wichtigste zur EU-Restschuldbefreiung
Ja. Für alle Insolvenzanträge, die nach dem 30. September 2020 gestellt wurden und werden, gelten die neuen Regelungen zur EU-Restschuldbefreiung. Diese erfolgt bereits nach drei Jahren, ohne dass der Schuldner hierfür bestimmte Mindestbeträge bezahlen muss.
Ja, das Insolvenzgericht erteilt nach drei Jahren die EU-Restschuldbefreiung, sodass alle alten Schulden, die bereits vor der Insolvenzeröffnung bestanden, wegfallen.
Ja, das ist möglich, sofern Sie die gesetzlichen Sperrfristen einhalten. Wenn Sie nach dem 30.9.2020 bereits einmal die Restschuldbefreiung beantragt und diese auch erteilt bekommen haben, müssen Sie elf Jahre warten, bis Sie einen erneuten Antrag stellen können. Mehr erfahren Sie in diesem Abschnitt.
Inhalt
1) EU-Restschuldbefreiung schon nach drei Jahren

Wer ab dem 1. Oktober 2020 einen Antrag auf Privatinsolvenz stellt, muss sich nur noch drei Jahre gedulden, bis ihm das Insolvenzgericht die beantragte Restschuldbefreiung erteilt. So lange dauert nunmehr die Wohlverhaltensphase.
Diese noch relativ neue Regelung geht auf das „Gesetz zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens“ zurück, mit dem der deutsche Gesetzgeber die EU-Richtlinie 2019/1023 zur Restschuldbefreiung umgesetzt hat.
Nach dieser Richtlinie waren alle Mitgliedsstaaten der EU verpflichtet, die Restschuldbefreiung für Unternehmer in nationales Recht umzusetzen. Darüber hinaus beinhaltete die Richtlinie auch die Empfehlung, dass Verbraucher ebenfalls nach drei Jahren in den Genuss eines Schuldenerlasses kommen sollten. Der deutsche Gesetzgeber ist auch dieser Empfehlung nachgekommen.
Mittellose Menschen, wie beispielsweise Hartz-4-Empfänger können weiterhin eine Verfahrenskostenstundung beantragen, wenn sie nicht in der Lage sind, die Verfahrenskosten aufzubringen. Damit steht auch ihnen der Weg zur EU-Restschuldbefreiung offen. Weitere Informationen zur Restschuldbefreiung nach drei Jahren, haben wir im Video für Sie zusammengefasst:
2) Dreijährige Verfahrensdauer nicht mehr an Mindestbetrag geknüpft
Vor dieser Gesetzesänderung war eine Restschuldbefreiung nach drei Jahren nur dann möglich, wenn es dem Schuldner gelang, in diesem Zeitraum sowohl 35 % seiner Schulden als auch sämtliche Verfahrenskosten zu begleichen. Diese Hürde stellte sich allerdings für die meisten als zu hoch heraus.
Nunmehr erhalten Schuldner die EU-Restschuldbefreiung, ohne dass sie solche Mindestbeträge bezahlen müssen, wenn sie ihren Insolvenzantrag nach dem 30. September 2020 gestellt haben bzw. stellen.
Der gerichtliche Schuldenerlass steht aber nach wie vor unter dem Vorbehalt, dass sich der Schuldner redlich verhält und seinen Obliegenheiten nachkommt. Dazu erfahren Sie mehr in diesem Abschnitt.
Weiterführende Ratgeber rund um die Restschuldbefreiung:
3) Übergangsfristen für ältere Insolvenzverfahren

Für ältere Restschuldbefreiungsverfahren, die vor dem 1. Oktober 2020 beantragt wurden, gelten diese neuen Regelungen nicht. Diese Schuldner müssen im Regelfall die sechsjährige Wohlverhaltensphase durchlaufen, wenn sie die folgenden Bedingungen für eine Verfahrensverkürzung nicht erfüllen können:
- Verkürzung auf drei Jahre: Bezahlung aller Verfahrenskosten plus Tilgung von 35 % der Schulden
- Verkürzung auf fünf Jahre: Bezahlung aller Verfahrenskosten
Eine kleine Änderung gibt es aufgrund der Neuregelung zur EU-Restschuldbefreiung für Verfahren, die zwischen dem 17. Dezember 2019 und dem 30. September 2020 beantragt wurden. Sie profitieren von einer staffelweisen Verkürzung ihrer sechsjährigen Wohlverhaltensphase. Diese Staffelung gestaltet sich wie folgt:
| Insolvenzantrag gestellt am | Dauer der Wohlverhaltensphase / Abtretungsfrist |
|---|---|
| 17.12.2019 - 16.1.2020 | 5 Jahre und 7 Monate |
| 17.1.2020 - 16.2.2020 | 5 Jahre und 6 Monate |
| 17.2.2020 - 16.3.2020 | 5 Jahre und 5 Monate |
| 17.3.2020 - 16.4.2020 | 5 Jahre und 4 Monate |
| 17.4.2020 - 16.5.2020 | 5 Jahre und 3 Monate |
| 17.5.2020 - 16.6.2020 | 5 Jahre und 2 Monate |
| 17.6.2020 - 16.7.2020 | 5 Jahre und 1 Monat |
| 17.7.2020 - 16.8.2020 | 5 Jahre |
| 17.8.2020 - 16.9.2020 | 4 Jahre und 11 Monate |
| 17.9.2020 - 30.9.2020 | 4 Jahre und 10 Monate |
4) Sperrfristen für wiederholte EU-Restschuldbefreiung
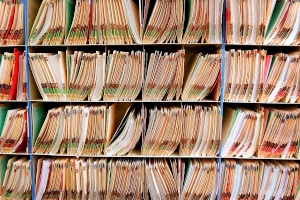
Hat ein Schuldner nach dem 1. Oktober 2020 eine Privatinsolvenz mit Restschuldbefreiung beantragt und erteilt ihm das Gericht daraufhin eine EU-Restschuldbefreiung, so kann er erst nach elf Jahren einen neuen Antrag stellen. Innerhalb dieser Sperrfrist ist ein erneuter Antrag laut § 287a Abs. 2 Nr. 1 Insolvenzordnung (InsO) unzulässig.
Außerdem dauert das Restschuldbefreiungsverfahren – also die Wohlverhaltensphase – in diesem Fall fünf und nicht drei Jahre.
Die anderen Sperrfristen gelten weiterhin unverändert:
- Fünfjährige Sperrfrist: Das Gericht hat die Restschuldbefreiung bereits einmal versagt wegen der Verurteilung des Schuldners zu einer Insolvenzstraftat.
- Dreijährige Sperrfrist: Das Insolvenzgericht hat die Restschuldbefreiung bereits einmal versagt, weil der Schuldner seine Auskunfts- und Mitwirkungspflicht, die Erwerbsobliegenheit oder sonstige Obliegenheiten verletzt oder falsche Angaben in Verzeichnissen gemacht hat.
Weitere Ratgeber rund um die Insolvenz im EU-Ausland:
5) Obliegenheiten zur EU-Restschuldbefreiung
Um die EU-Restschuldbefreiung zu erlangen, muss der Schuldner verschiedenen Obliegenheiten nachkommen. Tut er dies nicht, können seine Insolvenzgläubiger die Versagung der Schuldenbefreiung beantragen.
- Erwerbsobliegenheit: Der Schuldner muss einer angemessenen Arbeit nachgehen oder sich ernsthaft um eine Arbeitsstelle bewerben. Er hat seine Bemühungen nachzuweisen und darf zumutbare Jobangebote nicht ablehnen.
- Auskunftspflichten: Wechselt der Schuldner seinen Job oder zieht er um, muss er dies dem Insolvenzgericht und dem Treuhänder sofort mitteilen. Auf Verlangen hat Auskunft über Einkommen und Vermögen zu erteilen.
- Herausgabeobliegenheit: Erbschaften und Schenkungen (mit Ausnahme von „gebräuchlichen Gelegenheitsgeschenken“ sind an den Treuhänder zur Hälfte herauszugeben. Gewinne, zum Beispiel aus einer Lotterie, muss der Schuldner in voller Höhe abgeben.
- Bescheidener Lebensstil: Der Schuldner darf keine unangemessenen Verbindlichkeiten eingehen.
Die EU-Restschuldbefreiung ist außerdem an die Bedingung geknüpft, dass der Schuldner nur an den Treuhänder zahlt und nicht an die Gläubiger. Er darf „keinem Insolvenzgläubiger einen Sondervorteil verschaffen“.
Im Video zusammengefasst: Die Restschuldbefreiung
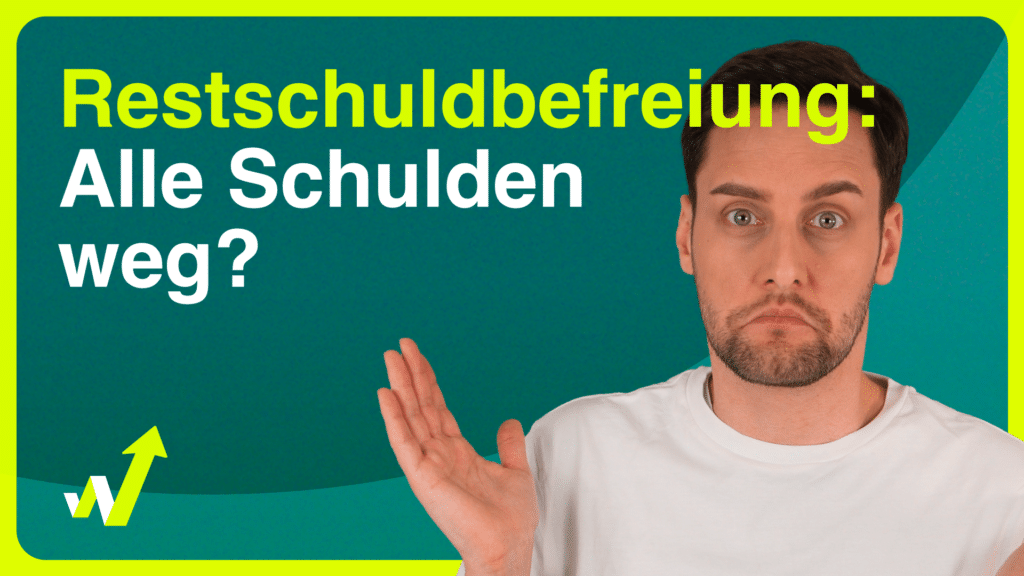

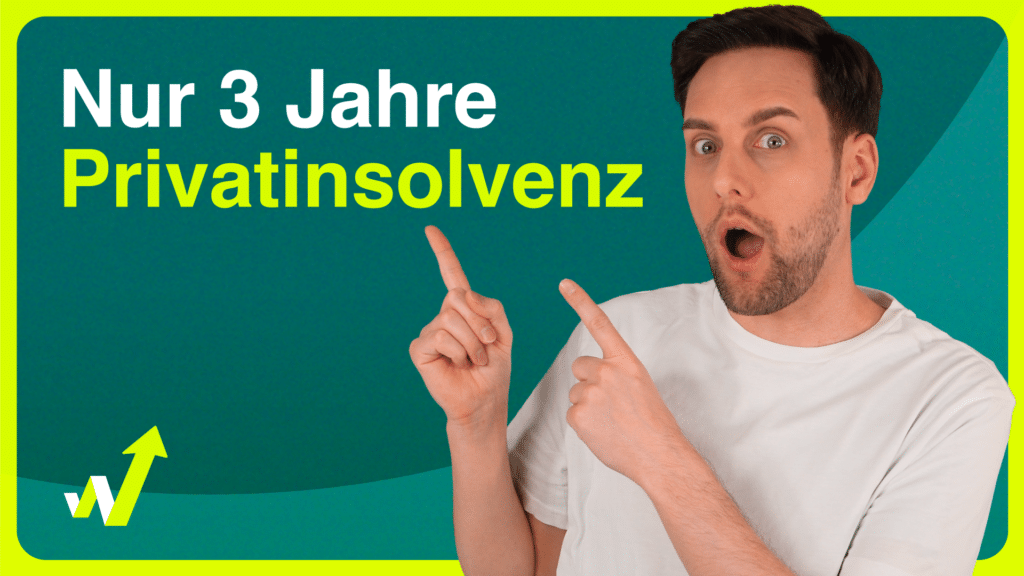

 (27 Bewertungen, Durchschnitt: 4,33 von 5)
(27 Bewertungen, Durchschnitt: 4,33 von 5)